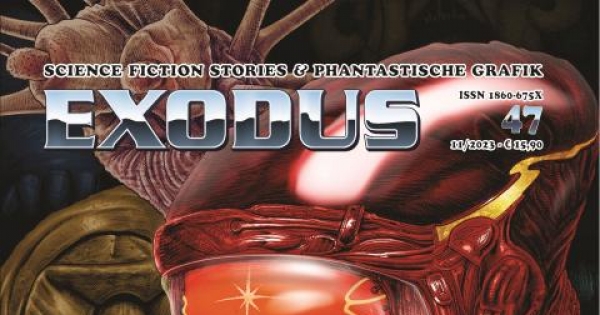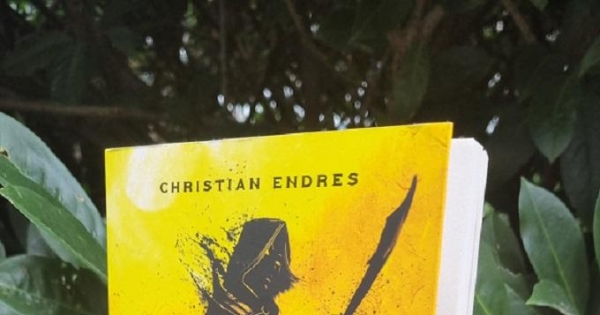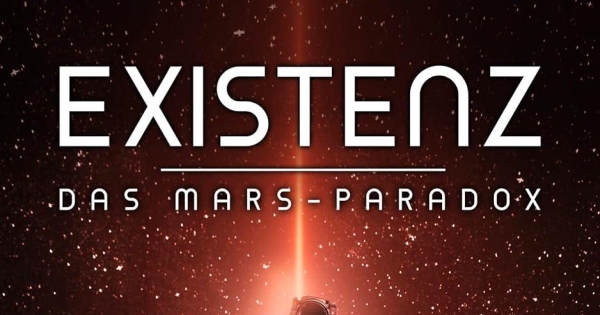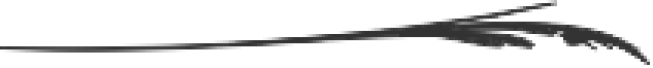Zu dunkler Stunde ist nichts so gespenstisch wie die Wahrheit.
Als ich die Augen aufschlug, war es wenige Minuten nach Mitternacht.
„Nicht doch“, kam es genervt über meine Lippen, während ich mich ungelenk auf dem Sofa hochkämpfte. In meinem Nacken knackte es und ich kam nicht umhin mich zu fragen, wie es meine Patienten auf diesem unbequemen Polstermöbel, oftmals völlig reglos, aushalten konnten. Aber die Themen, die in diesem meist halb abgedunkelten Raum besprochen wurden, waren garantiert weit unbequemer, also fiel das körperliche Unbehagen wohl nicht ins Gewicht.
Nach meinem letzten Patienten an diesem langatmigen Donnerstag hatte ich eines der Bleikristallgläser vom Regal genommen, mir einen kostbaren Schluck Whiskey aus der vor den Augen Fremder wohlverborgenen Glaskaraffe gegönnt und war dann auf die Couch niedergesunken, um kurz meine Gedanken schweifen zu lassen und gegen den bohrenden Kopfschmerz anzukämpfen. Wenigstens den einen oder anderen Wimpernschlag lang.
Das war vor mehr als vier Stunden gewesen.
Nun war es durchaus nicht der Fall, dass zuhause jemand auf mich gewartet hätte. Mein Heim war so leer wie an den meisten Tagen mein Herz. Kein fürsorglicher Partner, keine Kinder, die sich nach ihrer Mutter sehnten, noch nicht mal eine selbstverliebte Katze. Von den ohnehin vertrockneten Topfpflanzen abgesehen, gab es zwischen diesen angeblich trauten vier Wänden nichts, das von meiner Gegenwart profitiert hätte. Oder ich von seiner. Aber wahrscheinlich wäre es angenehm gewesen, meine förmliche Arbeitskleidung abzulegen, in meinen Bademantel zu schlüpfen und auf meinem gemütlichen Sofa, mit einem guten Buch in der Hand, einzuschlafen. Sei es drum, diese Gelegenheit hatte ich verpasst und ich gab mich erst gar nicht der Illusion hin, diese Wunschvorstellung morgen Abend wahr werden zu lassen. Tief in mir wusste ich, dass ich die Gemütlichkeit meiner Wohnung mied wie die intime Gesellschaft von Menschen. Unglück, Schmerz und Trauer umgaben mich den ganzen Tag über, ich war einfach nicht fähig dazu, mich mit dem Beginn der Nacht in die trügerische Behaglichkeit zu flüchten. Mein Innerstes war so düster wie die Geschichten meiner Patienten, aber wenigstens war meine Finsternis von unerschütterlicher Beständigkeit.
Eine flüchtige Bewegung am Rande meines Gesichtsfeldes riss mich aus den Gedanken, in denen ich mich abermals verloren und die mich fast wieder in das Land des Schlafes entführt hätten. Im gähnend schwarzen Loch der offenstehenden Tür, die in den Empfangsbereich hinausführte, konnte ich vage einen Schatten ausmachen, dessen Schwarz sich selbst noch von der rabenschwarzen Nacht in diesen verlassenen Räumen abzuheben schien.
Es war keine optische Täuschung.
Etwas bewegte sich dort.
Jemand.
Ich stieß einen stumpfen Schrei aus, der an meiner Angst erstickte, sprang vom Sofa hoch und taumelte, die Hände abwehrend vor meinen Körper ausgestreckt, rückwärts.
„Fürchten Sie sich nicht, ich will Ihnen nichts anhaben“, erklang eine dunkle Stimme und der Schatten löste sich aus dem Türrahmen, manifestierte sich.
„Selten erst hat sich ein ungeladener Gast mit diesen Worten angekündigt und dann auch Wort gehalten“, entgegnete ich. Die spitzfindige Boshaftigkeit meiner Feststellung verlieh mir eine rhetorische Sicherheit, mit der mein Körper allerdings nicht standhalten konnte. Beinahe hätte ich mein Herz hämmern und mein Blut rauschen hören.
„Würde ein Gast, der kommt, weil er die Hilfe einer Therapeutin benötigt, diese denn belügen?“, fragte der Mann, der mit drei raschen Schritten in den, von einer einzelnen Leselampe spärlich beleuchteten, Raum getreten war, und ein Lächeln zierte sein fahles Gesicht. Er war Anfang dreißig, sein Haar, das ebenso schwarz war wie seine altmodisch anmutende Kleidung, hatte er aus der Stirn gekämmt, seine Haltung war aufrecht, aber dennoch unterwürfig.
„Dieser Gast würde mich genauso belügen wie jeder andere. Vor allem der Wunsch nach Hilfe hält die Wahrheit tief in sich verborgen und offenbart sie erst nach mehrmaligem Durchleuchten. Wenn der Hilfesuchende sie überhaupt jemals preisgibt.“
„Darf ich?“, fragte der Mann und deutet weiter hinein in den Raum, als hätte er ihn nicht schon längst betreten.
„Was das angeht, haben Sie sich bereits selbst geholfen“, antwortete ich und setzte nach: „Wer hat Sie überhaupt reingelassen.“
„Ich traf eine Mieterin, eine junge Frau mit kurzem rotem Haar, am Hauseingang. Sie war so nett mich hereinzubitten. Die Tür zu Ihrer Praxis war nur angelehnt, deshalb war ich wiederrum so frei, dies als Einladung zu werten, zumal ich das Haus ohnehin schon betreten hatte.“
Ich runzelte die Stirn. Wer würde mitten in der Nacht einen Fremden ins Haus lassen? Und warum um alles in der Welt hatte meine Sprechstundenhilfe vergessen, die Tür zur Ordination abzuschließen? Das entsprach gar nicht ihrem gewissenhaften Wesen.
„Was auch immer Sie hierher geführt hat, es ist nach Mitternacht. Dermaßen spät empfange ich keine Patienten. Rufen Sie an, lassen Sie sich von meiner Assistentin einen Termin geben, dann können wir das Gespräch, das Sie unpassender Weise mitten in der Nacht suchen, im Laufe der nächsten Tage führen“, belehrte ich ihn und gab mir erst gar keine Mühe, den Zorn in meinen Worten zu kaschieren. Ich selbst konnte darüber hinaus den Unterton der Erleichterung hören, immerhin war die Angst der Wut gewichen, was ich als gutes Zeichen wertete. Mein ungebetener Gast war seltsam, aber ich spürte mit einem Mal, dass mir von ihm keine Gefahr drohte.
„Ich fürchte“, fuhr er fort und in seiner Stimme schwang aufrichtiges, fast schon schmerzhaftes Bedauern mit, „was mein Erscheinen mitten in der Nacht angeht, bleibt mir leider keine allzu große Wahl. Darf ich?“, fragte er ein weiteres Mal und deutete dabei auf das Sofa und diesmal konnte ich ihm die Bitte nicht abschlagen. Ein einziger Blick in seine dunkelgrünen Augen hatte mich überzeugt.
Die nächsten Wochen verbrachte ich nahezu jeden Abend in meinen Ordinationsräumen. Ich trank Whiskey, las in Büchern, die ich bereits vor Ewigkeiten erworben hatte und deren Seiten speckig und deren Worte abgelesen waren, ich schlief auf dem Sofa und verlor mich in wahnhaften Fantasien.
Meine Tür stand immer offen.
Erst ertappte ich mich noch dabei, dass ich nach beendeter Arbeit nicht nachhause ging, sondern in der Praxis ausharrte wie ein verwirrtes Schulmädchen. Ich schalt mich einfältig und willensschwach. Doch bald schon gestand ich mir meine Neigung ein und aus dem angeblich zufälligen Verweilen wurde ein bewusstes, ein sehnsüchtiges Warten.
Damian, so nannte er sich selbst und ich hatte keinen Grund, an seinem Namen zu zweifeln – wo doch ein selbst gewählter Name meist sprechender ist als der, den uns die Eltern auferlegen – besuchte mich mehrmals die Woche. Trat an meine Schwelle, wisperte meinen Namen, riss mich aus meinen Träumen.
Cathrin
Wenn er sprach, hing ich an seinen Lippen, wenn er schwieg, verloren wir uns im Augenblick. War die Stunde um, ging er, wie er gekommen war.
Lautlos hinaus in die Nacht.
So mystisch seine Erscheinung war, so alltäglich war das, was ihn bedrückte. Waren unsere Treffen von einem überirdischen Glanz beseelt, war seine Qual die Qual eines jeden.
Ich möchte über meine Mutter sprechen, hatte er gesagt und ich hatte verstanden, bevor ich seine weiteren Worte vernommen hatte. Fast schon marterte es mich, dass eine dermaßen elegische Existenz einer solch kindlich banalen Folter unterworfen war.
Seine Mutter.
Sie war lang weg gewesen, sehr lang, unbeschreiblich lang. Auf einer Reise vielleicht, oder einfach nur nicht an seiner Seite. In einem anderen Land, einer anderen Stadt, auf jeden Fall anderswo. Bald würde sie zurückkehren und das tun, was alle Mütter tun: über ihre Kinder urteilen. Doch das Urteil, mit dem sie Damian bedenken würde, wäre nicht bloß ein ungerechtes, es wäre ein vernichtendes.
Er hatte sich nicht an die strengen Regeln der Familie gehalten.
Er war maßlos gewesen und menschlich.
Er hatte sich in Taten und Worten gegen die übermächtige Mutter aufgelehnt. Und er hatte etwas wahrhaft Unaussprechliches getan, das er bislang auch vor mir verborgen hielt. Aber die Rückkehr der Mutter würde seine Schande enthüllen und ihn vor der Familie und der Welt bloßstellen.
Ich hatte das bereits unzählige Male gehört. In unterschiedlichste Worte gefasst und mit schauderhaften Metaphern illustriert, aber immer denselben Kern der Wahrheit offenbarend. Das abhängige Kind war der Mutter Untertan, selbst dann, wenn die Unterwerfung nicht real, sondern bloß individuelle Projektion war. Ein meist belangloser Komplex, der uns alle unterjochte. Eine aus dem Schmerz geborene Schuld, die gemeinsam mit unseren Körpern bei der Geburt auf die Welt gepresst worden war. Absolut beliebig. Aber Damians Worte klangen, als würde es um sein nacktes Überleben gehen. Ich wusste nicht, was mich mehr erschütterte, dass er fest davon überzeugt war, dass der Tod sich ihm in Gestalt seiner Mutter schleichend näherte, oder dass ich ihm Glauben schenkte.
In einer stürmischen Nacht schließlich trat Damian mit einer Energie, die nicht nur die ungestüme Leidenschaft des Wetters mit in die dunklen Gemächer brachte, abermals in mein Leben, das er gleichermaßen bereicherte wie dominierte. Längst hatte die Sehnsucht überhandgenommen und mein Tagesgeschäft war bloß noch dazu gedacht, mich durch sein möglichst rasches Vergehen der Nacht näherzubringen.
Sein sonst in sanften Wellen aus dem Gesicht gekämmtes Haar war vom Sturm zerzaust, seine vornehme Kleidung völlig durchnässt, seine grünen Augen leuchteten im Fieberwahn.
„Damian!“, entfuhr mir ein verhaltener Aufschrei und ich eilte quer durch den Raum auf ihn zu. Erschrocken, als würde ihn die Zurschaustellung meiner Besorgnis bedrängen, wich er einen Schritt zurück, doch hielt er gleich darauf inne. Regenwasser tropfte von seinem Gehrock auf meinen über hundert Jahre alten Parkettfußboden, aber in diesem Moment waren mir meine materiellen Güter einerlei.
Es gab nur ihn, vielleicht mich und möglicherweise gab es uns.
„Cathrin …“, hauchte er und sein Lippen zitterten, was meinem Namen ein betörendes Timbre verlieh. Mein Hals fühlte sich schlagartig trocken an und die Hand, die ich nach ihm ausstreckte wie nach einem scheuen Tier, das ich nicht vertreiben wollte, übernahm sein Zittern. Dieser Mund … ich wollte ihn berühren, ihn am liebsten mit meinem verschließen und in einen Kuss eintauchen, der intimer war als jede Berührung, die ich in meiner bisherigen Existenz geschenkt bekommen oder erzwungen hatte.
„Teuerster“, perlte das einzelne Wort voller Hingabe von meinen Lippen und ein Schwall an Liebesbekundungen wollte ungebremst folgen, doch die Verzweiflung in seinen Augen ließ mich schweigen. Stattdessen vollendete ich die zaghafte Bewegung meiner Hand und berührte sanft die rechte Seite seines schlanken Halses.
Als hätte ich ihn mit einem glühenden Eisen gestreift, schrie er auf, schlug meine Hand zur Seite und fauchte wie ein Panther, den man in die Enge getrieben hatte:
„Fass mich nicht an!“
Entsetzt riss ich die Augen auf und stammelte: „Verzeih mir … was … was hab ich dir getan?“
Sein schmerzverzerrtes Gesicht entspannte sich wieder und ein Schleier legte sich über seinen hypnotischen Blick.
„Du musst mir verzeihen, Cathrin. Es war nur ein Reflex, ich kann es nicht kontrollieren … kann mich nicht kontrollieren.“
Intuitiv dachte ich an die zum Schlag erhobene Hand einer Mutter und verstand seinen Schmerz. Doch wie sich gleich darauf offenbaren sollte, missverstand ich ihn.
„Zeig mir deine Hand“, forderte er mich auf und ich tat wie mir geheißen. Der gebieterische Klang seiner Stimme ließ meine Haare im Nacken zu Berge stehen. Ich hätte ihm nicht widersprechen können und noch weniger wollte ich es, denn ich dürstete nach mehr. Jede Faser meines Körpers gierte danach, dass diesem harmlosen Befehl weitere folgen würden. Unangemessene, entwürdigende, animalische.
„Dein Ring“, sagte er und seine Augen verengten sich, während er ihn eingehend betrachtete. Argwöhnisch trat er ganz nah an mich heran und neigte sein Haupt hinab zu meinen langgliedrigen Fingern, um das aufwendig gestaltete Schmuckstück eingehend zu betrachten. Dann richtete er sich auf und kam meiner Wange mit seinem Mund so nahe, dass er mich fast berührt. Eine Hitze, die ich nie für möglich gehalten hätte, weil nichts jemals zuvor in mir dermaßen gebrannt hatte, durchfloss meinen Körper und ich fühlte mich unendlich lebendig. Wahrhaftig lebendig. Ich wollte mich an ihn pressen, jeden Zentimeter seiner blassen Haut kosten, die exklusive Lebendigkeit genießen und ausleben.
„Es ist dein Ring“, flüsterte er in mein Ohr und auch sein Atem ging schwer und unregelmäßig.
„Was ist damit?“, fragte ich und ein eiskalter Schauer lief in Erwartung des Unaussprechlichen über meinen schweißnassen Rücken. Was immer es war, sein Geheimnis stand kurz davor gelüftet zu werden. Damian würde sich mir endlich anvertrauen.
„Er ist aus Silber“, antwortete er und Abscheu entstellte seine Stimme.
„Ja, das ist er. Aber welche Rolle spielt das?“, wollte ich wissen.
„Silber … es verletzt mich“, fuhr er fort.
„Es verletzt dich?! Was willst du mir damit sagen?“
„Ich … Cathrin … ich bin ein Vampir.“
„Du bist was?“, rief ich erstaunt aus und sofort ging meine Verwunderung in ein hysterisches Kichern über. „Du nimmst mich auf den Arm“, gluckste ich übermütig, ließ von Damian ab, um mich an der Lehne eines Stuhls festzuhalten, und bog mich förmlich vor Lachen. Mein Körper wurde von unkontrollierbaren Salven durchgeschüttelt und mein Zwerchfell krampfte. Als ich wieder zu Atem gekommen war, strich ich mir eine lose Strähne des blonden Haares aus der Stirn und grinste Damian an. Dieser erwiderte meine Ausgelassenheit jedoch nicht. Sein Blick war starr, seine Körperhaltung verkrampft.
„Du … du hast das ernst gemeint. Du … glaubst das wirklich“, murmelte ich und ließ mich auf den Stuhl sinken, der mich eben schon davor bewahrt hatte umzufallen. Damian schüttelte resignierend seinen Kopf. Ich konnte nicht sagen, ob es Regenwasser war, das aus seinem Haar und über sein Gesicht floss, oder Tränen.
„Ich glaube es nicht“, sagte er. „Ich weiß es.“
Im Laufe unserer nächsten Treffen tauchte ich immer tiefer in seine Psychose ein. Das weite Land seines Geistes war gleichsam erschreckend und betörend.
Glaubte ich ihm?
Selbstverständlich nicht. Es war für mich unmöglich, ihm zu glauben, wo ich es doch besser wusste.
Wollte ich ihm glauben?
Ich konnte es schlicht und ergreifend nicht sagen. Aber ich war mir absolut sicher, dass ich seine Nähe noch mehr brauchte als zuvor und dass ich seine Geschichte unbedingt hören wollte. Auch, wenn es bloß ein Märchen war, das ihm dabei half, eine unaussprechlich schmerzhafte Wahrheit zu verdrängen.
Fürchtete ich diese Wahrheit?
Das mit Sicherheit, aber diese Furcht war viel schwächer als meine Liebe und hatte demnach keinerlei Macht über mich.
Damians eigene Legende begann damit, dass er im Paris des 18. Jahrhunderts, im sozial gebeutelten Vorfeld der Französischen Revolution, geboren wurde. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater, ein hart arbeitender Gerber, verstarb früh, der kleine Damian konnte sich kaum an ihn erinnern. Er hatte nur das Bild vor Augen, wie sein Vater sich abends über ihn gebeugt hatte, um ihm zärtlich die Wange zu streicheln und damit böse Träume zu vertreiben. Außerdem konnte er sich des Gestanks besinnen, den sein Vater immer hinter sich hergezogen hatte wie einen dämonischen Schatten. Das war alles.
Als seine Mutter von einem Betrunkenen überfallen, geschändet und ermordet wurde, übergab man den damals achtjährigen Damian der Obhut des staatlichen Waisenhauses.
Dort fand sie das schöne Kind mit den schwarzen Locken und den dunkelgrünen Augen.
Die Mutter.
Alma Mater.
Sie zog Damian auf wie ihr eigenes Fleisch und Blut. Wie ihre eigene Brut. Er war ihr deshalb treu ergeben und wich niemals von ihrer Seite, selbst dann nicht, als er erkannte, dass die verehrte Mutter nicht mehr war als ein blutrünstiges Monster, an dem der Zahn der Zeit spurlos vorüberging.
An seinem achtundzwanzigsten Geburtstag befand die Mutter, dass seine einzigartige Schönheit ihren Zenit erreicht hatte und sie machte ihn endgültig zu einem der Ihren. Sie verwandelte ihn.
Und das war er nun.
Verwandelt.
Er irrte, alterslos und emotionslos wie seine Ziehmutter, durch die Wirren der Zeit und gab sich der Dekadenz ebenso hin wie der Entbehrung. Auf all seinen Wegen, untrennbar mit dem Schicksal seiner Art verschlungen, fand er sich einem strengen Verhaltenskodex unterworfen. Seine Unsterblichkeit hatte ihn befreit, die verschworene Gemeinschaft der Vampire legte ihn in Fesseln. Die Welt stand ihm offen, aber seine stoffliche Existenz verdammte ihn dazu, die Schranken des Möglichen zu respektieren.
Sonnenlicht, Knoblauch und Silber konnten tödlich sein, diese Erfahrung hatte Damian zweimal am eigenen Leib gemacht und war als Unsterblicher nur knapp seinem Ende entgangen. Das Geheimnis um die Sippschaft musste gewahrt werden, man durfte sich niemandem anvertrauen. Spiegel galt es in Gegenwart der Menschen zu meiden, wollte man nicht durch das fehlende Spiegelbild enttarnt werden.
Er musste sich an all diese und viele weitere Gesetze halten, denn die Mutter wachte akribisch über ihre unzähligen Kinder, die sie in tausenden von Jahren kreiert hatte. Selbst wenn sie sich in ihren traumlosen Schlaf, der ein halbes Jahrhundert andauerte, zurückzog und ihren Körper in kalter Friedhofserde zu regenerierender Ruhe bettete, schwebte der rastlose Geist der Mutter über ihren Sprösslingen. Würde eines ihrer Wesen sich eine Verfehlung leisten, würde sie diesen Verräter am Blute sofort nach ihrem Erwachen zur Rechenschaft ziehen.
Der Tag dieses Gerichts stand für Damian, der einen unaussprechlichen Fehler begangen hatte, unmittelbar bevor. Wie er selbst zugab, hatte er unzählige der Vorgaben bewusst missachtet, aber bloß ein Frevel würde in den Augen der nährenden Urmutter unverzeihlich sein und sie würde bald erwachen.
Und dann würde sie den ehrlosen Abkömmling ihrer unmittelbaren Blutlinie vernichten.
Vieles an Damians Geschichte war betörend, aber nur eines war für mich fatal.
Er musste sich nähren.
Sich zu nähren, hieß zu töten.
Er beschrieb, wie er die auserwählten Menschen bezirzte, sie in eine sexuelle Abhängigkeit trieb und sie schlussendlich mit seinem nackten Körper fest umschlungen hielt, während er sich an ihrem Blut labte.
Nachdem er mir davon erzählte hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, in seinen Armen zu sterben. Selbst wenn Damians Verbrechen nicht mehr als die Wahnvorstellungen eines kranken Geistes waren, so hatte diese Vision etwas Tröstendes, Erotisches. Getauft in meinem eigenen Blute, war dieser Tod die ultimative Vereinigung.
Der Mörder, der Damian womöglich war, konnte meine lang ersehnte Erlösung sein.
Während die Sonne hoch am Himmel stand, hing ich Tagträumen nach, in denen der Todesengel mit den grünen Augen meinen willenlosen Körper schmeckte, besetzte, absorbierte. Im Angesicht des Todes ging ich, mich an der Nacktheit seines perfekten Körpers ergötzend, in ekstatische Flammen auf.
Wenn die Nacht sich dann über das Land legte und Damian leibhaftig vor mir stand, um mich mit seinen Worten weiter hinab in seine Welt zu zerren, hoffte ich auf die endgültige Erfüllung meiner Träume.
Doch mein Hoffen schien vergebens.
Nach einem schier endlosen Tag war ich auf der Couch in meiner Praxis eingeschlafen. Mittlerweile war das zur Gewohnheit geworden. Immerhin schlief ich nicht nur, ich wartete.
Wartete auf ihn.
Es war jenes mir wohlvertraute Flüstern, das mich zärtlich weckte.
„Cathrin, wach auf …“, schmiegte sich die Melodie meines Namens an mich und ich öffnete die Augen.
Damian saß bei mir auf der Couch, hatte sich zu mir hinab gebeugt und fuhr mit der Hand durch mein blondes Haar, das in goldenen Wellen über das Kissen fiel. Ich wollte ihm erzählen, dass ich von ihm geträumt hatte, doch bevor ich zu Wort kommen konnte, legte er mir einen Finger auf meine Lippen.
„Schweig still. Ich bin gekommen, um dir etwas mitzuteilen. Ich habe einen Entschluss gefasst und du hast mir dabei geholfen. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, was mich in den Augen meiner Sippe zum Frevler macht.“
Ich richtete mich nervös auf, schaute ihm tief in die Augen und hielt den Atem an.
„Cathrin … ich liebe eine Menschenfrau. Nicht, weil ich mich an ihr nähren will oder lustvoll an ihr vergehen. Nein, ich liebe sie aufrichtig und unwiderruflich.“
„Du liebst eine Frau“, wiederholte ich andächtig.
„Es ist mächtiger, als ich es mir jemals erträumt hätte“, sprach er weiter, griff lächelnd nach meiner Hand und hielt sie inniglich umschlungen.
„Es ist die stärkste Macht im Universum“, hauchte ich und erwiderte sein Lächeln.
„Ich habe diese Frau lange beobachtet, bevor ich den Mut gefunden habe sie anzusprechen und ich habe sie damals bereits geliebt. Ich werde sie nicht verlassen. Doch Mutter wird meine Liebste und mich töten, wenn sie davon erfährt, dass ich bei ihr bleibe. Das weißt du. Deshalb müssen wir fliehen. Wir müssen es wenigstens versuchen.“
„Ich komme mit dir, wohin auch immer du gehst“, bestärkte ich ihn.
Aber der Ausdruck auf seinem Gesicht ließ das Lächeln auf meinem gefrieren.
„Du kommst mit mir?“, fragte er verwundert und schüttelte dann den Kopf. „Ich spreche doch nicht von dir. Die Frau, die ich verehre, wartet im Wagen vor dem Haus auf mich. Wir werden heute Nacht noch die Stadt verlassen. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden, weil du mir Mut gemacht hast. Du hast mich gelehrt, mich zu meiner Liebe zu bekennen. Mein ewiger Dank ist dir gewiss, aber nicht mein Herz.“
Das Zimmer drehte sich um mich und eine entsetzliche Leere, vor der mich einzig und allein mein höllischer Schmerz zu erretten wusste, streckte ihre unheilvollen Arme nach mir aus.
Sein ewiger Dank?
Was half mir aller Dank dieser elenden Welt, wenn ich genau nur das Eine wollte:
Seine gottverdammt Liebe!
„Bedanken willst du dich? Das willst du mir sagen? Nun, ich habe dir ebenfalls etwas mitzuteilen!“, fuhr ich ihn an. Es war der Donner der Unseligen, der tief aus meiner Kehle empor grollte und Damian zusammenzucken ließ. „Du denkst, du bist ein Vampir? Ein Scheißdreck bist du!“
Ich sprang von der Couch hoch und baute mich vor dem Häufchen Elend auf, das zusammengesunken dort kauerte und im Angesicht meiner Wut erzitterte.
„Aber ich bin ein Vampir“, flüsterte Damian störrisch und ich brach in teuflisches Gelächter aus.
„Du erinnerst dich sicher, dass ich dich schon mal ausgelacht habe. Ein Vampir? Ein elender Wurm bist du, ein verdammter Mensch! Und kannst du erahnen, woher ich das so genau weiß?“
Damian sagte nichts, aber er war auch weit davon entfernt zu schweigen. Ein unartikuliertes Jammern drang an mein Ohr und befeuerte meine Rage.
„Antworte!“, schrie ich ihn an und das hasserfüllte Wort hallte von den Wänden wider.
„Weil du eine Therapeutin bist?“, nuschelte er.
„Falsch. Ich weiß es, weil ich ein Vampir bin!“
Anmutig fuhr ich mit meinen langgliedrigen Fingern durch das blonde Haar und streifte langsam die Perücke von meinem kahlen Schädel. Meine Fingerknöchel knackten, als jedes der langen Glieder noch länger wurde. Das Haarteil in meinen Händen sah aus, als würden sich die blassen Beine einer überdimensionalen Spinne darum schließen und ich warf es achtlos in eine Ecke, wo es wie ein totes Tier liegenblieb. Mein immer breiter werdender Mund verzerrte mein engelsgleiches Gesicht fratzenhaft und meine strahlenden Augen wurden erfüllt von einem pechchwarzen Nichts, dem keine Menschenseele jemals standhalten hatte können.
„Und rate mal, was“, zischte ich und meine Stimme changierte, als würden tausend Zungen gleichzeitig aus mir sprechen und jeder einzelne Ton klang wie das schrille Kreischen von Fingernägeln auf einer Schiefertafel, „ich esse Knoblauch auf meiner Pizza. Wenn ich mir morgens die Zähne putze, dann blicke ich in einen Spiegel und bewundere meine erlesene Schönheit. Ich trage seit über zweihundert Jahren einen Silberring. Ich wurde nicht zu romantisch geschichtsträchtiger Zeit geboren, sondern bin, die mickrige Menschheitsgeschichte sprengende, tausende Jahre alt. Ich genieße das wärmende Sonnenlicht. Und die wenigen Gefährten meiner Art geben einen Dreck darum, wie ich mein verdammtes, ewiges Leben lebe.“
„Verschone mich!“, flehte mich Damian an und blickte zu mir hoch. Sein Gesicht war rot vor Panik, sein Mund stand nach Atem ringend halb offen und Tränen der Angst rannen über seine Wangen.
„Dich verschonen? Was denkst du denn von mir? Du glaubst, ich würde dich vernichten, wo ich dich doch … liebe? Wahrhaftig, das fürchtest du?“, fragte ich lauernd.
„Dann trinkst du also auch kein Menschenblut?“, antwortete er und seine Stimme war beseelt von der plötzlichen Hoffnung, an die er sich klammerte. Sachte setze ich mich wieder zu ihm auf die Couch und trocknete mit meinen Fingern, deren Schatten an der Wand tanzten wie Schilf im Wind, sanft seine Tränen.
„Das, mein Teuerster, habe ich nicht gesagt.“,
Unerbittlich grub ich die Finger meiner rechten Hand in sein Haar und riss ruckartig seinen Kopf zurück in den Nacken.
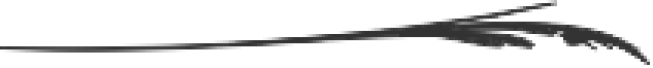
 |
Über die Autorin
Faye Hell (Schriftstellerin, Filmhistorikerin und Journalistin) beschäftigt sich bevorzugt mit den düsteren Gefilden von Kunst, Kultur und Gesellschaft.
In ihrer schriftstellerischen Arbeit verbindet sie subtiles Grauen mit expliziter Gewalt und Obszönität. Sie betreibt den Filmblog FILMGEFLÜSTER mit Faye Hell und ist freie Mitarbeiterin des DEADLINE-Filmmagazins.
Ihr aktueller Roman ist Das Zeitalter der Kröte (Amrun Verlag).
Nähere Informationen auf: www.fayehell.com
|