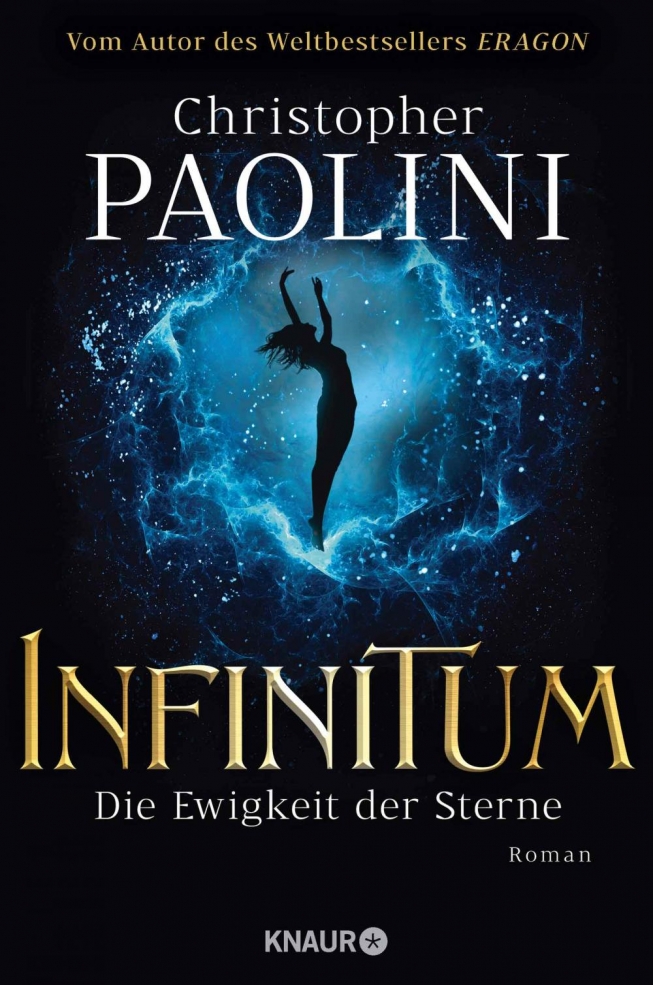INFINITUM: Die Ewigkeit der Sterne – Ein langer Review für eine lange Geschichte
Kommentare
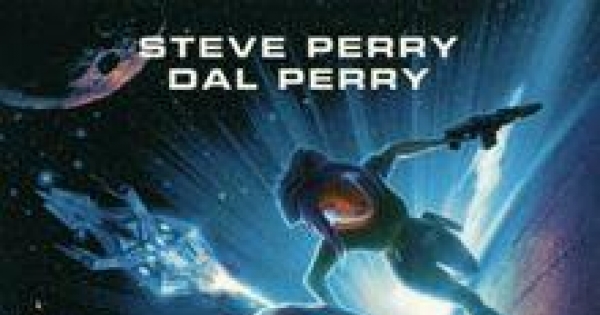
Retro-Rezi: Titan A. E. – Throwback ins Universum der Vergangenheit
Der Planet Erde wurde von Energiewesen, den Drej, ausgelöscht. Einige der Menschen konnten in riesigen Raumschiffen fliehen, doch leben sie jetzt als heimatlose Nomaden im All und führen ein ärmliches Leben.

Errungenschaft freigeschaltet! – Funny Future Fiction
Die App AchieveIt belohnt dich für das Abschließen von Aufgaben im Reallife. Vom regelmäßigen Wechseln der Unterwäsche bis hin zur Rettung von bedrohten Tierarten. Und das Beste ist: Du kannst dir dafür Orden ausdrucken, die jeder bewundern kann!

Omniworld – Dystopischer KI-Thriller
Omniworld ist besser als die Realität. Während die Welt dem Klimawandel zum Opfer fällt. hat die neue Metaverse-Plattform hat eine Technologie bereitgestellt, die alles in den Schatten stellt. Doch nur wenige sehen die Gefahren hinter dieser Evolution.
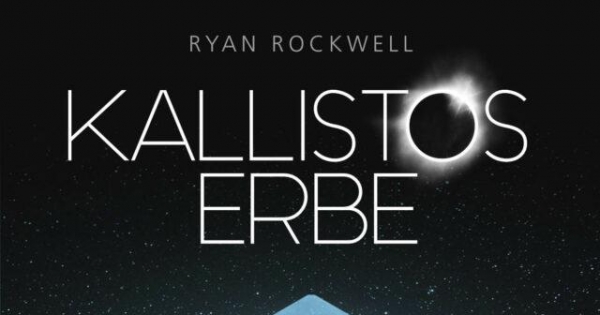
Kallistos Erbe – Ein ferner Mond mit einem dunklen Geheimnis
Carl Harding, frisch aus dem Kryoschlaf erwacht, soll auf dem Eismond Kallisto eine Stelle in der Zutrittskontrolle antreten. Doch eigentlich ist das für ihn nur ein Vorwand um herauszufinden, was mit seiner verstorbenen Schwester geschehen ist.

Talus - Die Runen der Macht – Magiegeladenes Spiel um Macht und Herzenswünsche
Nach der Dilogie um den mächtigen Zauberwürfel Talus kehren wir zurück in die Unterwelt, um Jessica und Emily bei ihrem nächsten Abenteuer zu begleiten. Ihre Herzenswünsche scheinen nicht mehr erfüllbar, nachdem der Würfel verloren ist. Oder doch?
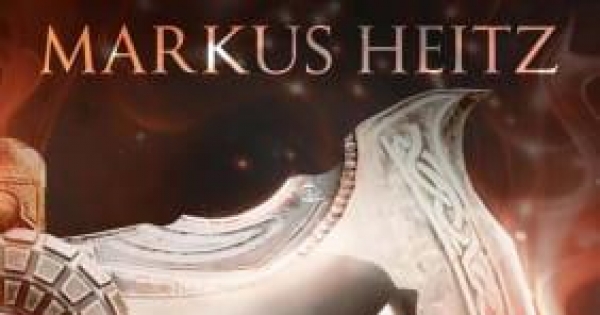
Rezension: Die Rückkehr der Zwerge 2 – Actionstarkes Zwerge-Bundle in gewohnt-klassicher Fantasy-Atmosphäre
Unendlich viele Zyklen sind vergangen seit Thungdil Goldhand als Held im Geborgenen Land bekannt wurde. Inzwischen haben sich verschiedene Regierungen gebildet, die das Land in relativem Frieden beherrschen.

Die Mitternachtsbibliothek – Von einem Leben weiter ins nächste
Nora Seed hat beschlossen, zu sterben. Das war eine recht spontane Entscheidung, als ihr Kater Voltaire überfahren wurde. Aber Nora stirbt nicht richtig, sie landet in der Mitternachtsbibliothek. Hier warten unzählige Leben auf sie – sie muss sich nur für eins entscheiden.

Nordic Clans 1 – Mein Herz, so verloren und stolz – Nordische Mythologie x Fantasy x Romance
Nordic Clans 1 entführt die Leser*innen in eine Welt, die nordische Mythologie und fantastische Elemente miteinander verbindet, um die spannende Geschichte von Yrsa und Kier zu erzählen, die verantwortlich für rivalisierende Clans sind. Die Frage ist nur: Wer gewinnt den Wettkampf um den wichtigsten Posten ihres Kontinents?

Dune - die Geschichte von Jessica Atreides – Dune für Dummies Teil 2
Im zweiten Teil der "Dune"-Reihe widmen sich die Autoren ganz der konfliktbelasteten Rolle von Jessica Atreides.
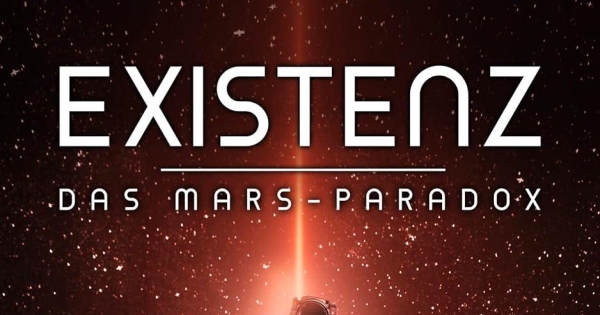
Existenz – Das Mars-Paradox
Die Menschheit hat eine Mars-Station errichtet, doch der Mord an Mikrobiologe Dr. Palmer und der Gedächtnisverlust des Teams erschüttern die Mission. ESA-Astronaut Nick Adam muss den Täter finden und deckt dabei furchtbare Geheimnisse auf.