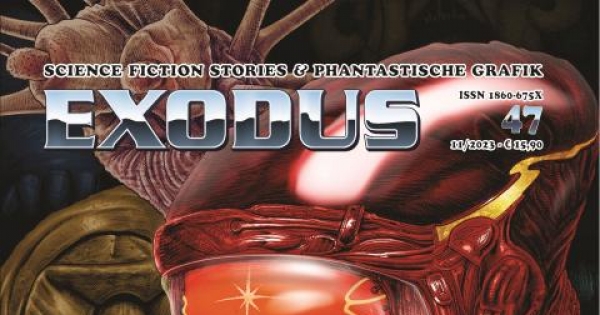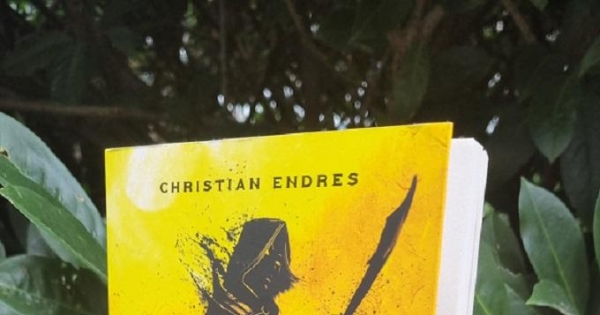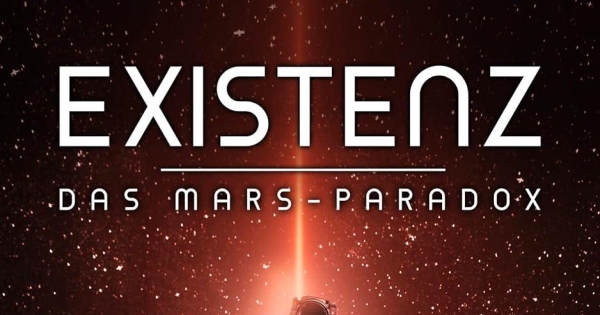Normalerweise mache ich das ja nie beim ersten Date, aber beim letzten Typen, den ich nach Cocktailbar und Spaziergang am Fluss mit nach Hause genommen habe, ist es dann doch passiert – ein Glas zu viel getrunken, einmal zu oft berührt, und schon erwische ich mich dabei, wie ich ihn ins Bad schleife und in die halb gefüllte Badewanne presse, wie ich meine Hufe auf ihn niedersausen lasse, bis der ganze Raum nass ist und das Wasser rot und ich nicht mehr sehen kann, ob das Knacken noch sein Schädel ist oder schon die Keramik.
Du hast es echt nicht leicht, wenn du insgeheim ein schottischer Pferdedämon bist.
Die Highlands habe ich nur noch grob in Erinnerung, meine Familie hat die Insel schon vor über zehn Jahren verlassen. Doch einmal Kelpie, immer Kelpie. Soweit man meinen Stammbaum zurückverfolgen kann, haben Mitglieder der Familie in wunderschöner Menschen- oder Pferdegestalt ahnungslose Wandernde in Flüsse und Seen gelockt und ihre Opfer ertränkt oder gefressen.
Ich hingegen würde lieber in Ruhe mein Studium beenden und vielleicht vor dem Abschluss jemanden kennenlernen, den ich nicht aus mangelnder Impulskontrolle zerstampfe, doch statt meine Nacht wie meine Mitstudierenden zu verbringen, muss ich einmal mehr eine Leiche verschwinden lassen. Dabei unauffällig zu bleiben ist glücklicherweise kein Problem – auf Kameras erscheinen Dämonen wie ich nur als verschwommener Fleck, und eventuelle Zeugen vergessen innerhalb von Minuten, dass sie mich gesehen haben. Außerdem ist der Fluss nicht weit entfernt. Ich habe den armen Kerl ungesehen versenkt und bin in die WG zurückgetrabt, bevor meine Mitbewohnerin auch nur ihre Tür geöffnet hat. Aus ihrem Zimmer dröhnt Deathrash oder Coregrind oder irgendein anderes Metal-Subgenre, mit dem ich nichts anfangen kann. Wie üblich hat sie von dem Tumult im Bad nichts mitbekommen.
Wieder in Menschengestalt putze ich all die roten Flecken weg, hole unsere Leiter, um auch die Spritzer an der über drei Meter hohen Altbaudecke zu erreichen, und habe die ganze Schweinerei früh genug beseitigt, dass ich vor der nächsten Vorlesung sogar noch ein paar Stunden Schlaf kriege.
Nickel treffe ich beim Frühstück in der WG-Küche, ihr blasses Gesicht hinter dunklem Haar versteckt, vor ihr nur ein angebissener Apfel. All das Schwarz ihrer Kleidung, Ringe und Fingernägel lässt die farbenfrohe Bemalung der Wand neben ihr umso bunter wirken: eine Zeichnung des Monsters von Loch Ness mit Hut, Sonnenbrille und falschem Schnurrbart, darüber ein Schriftzug: Sie werden mich niemals finden.
„Guten Morgen!“, sage ich mit einem Lächeln und hole meine Müslischale aus dem Regal. Nickel sagt nichts. Seit den letzten Semesterferien ist sie noch schweigsamer geworden, als sie ohnehin schon war. Früher war sie genauso fröhlich und mitteilsam wie ich, und auch optisch waren wir als Kinder kaum zu unterscheiden gewesen, strohblond und sommersprossig, fast wie Zwillinge in den gleichen farbenfrohen Pastellkleidern. Heute trifft all das nur noch auf mich zu.
„Sie haben wieder jemanden im Fluss gefunden“, sagt Nickel leise, ihre Stimme nur ein heiseres Krächzen.
„Das Leben ist kein Ponyhof“, antworte ich nur und prüfe aus dem Augenwinkel, ob ich sie wenigstens zum Schmunzeln bekomme. Nebenbei fülle ich mir Müsli ein. Aus der Packung rieselt nichts als Asche.
„Nickel, verdammt!“, rufe ich und springe auf. Sofort prüfe ich die Regale und den Kühlschrank. Natürlich sind auch die anderen Getreideprodukte verdorben. Und nicht nur Nickels Vorräte, sondern auch all das, auf dem klar erkennbar ein Zettel mit der Aufschrift Kelly klebt.
„Nicht schon wieder!“, sage ich und seufze.
Du hast es noch weniger leicht, wenn auch deine Mitbewohnerin insgeheim ein schottischer Pferdedämon ist.
Die meiste Zeit haben wir unsere wahre Natur unter Kontrolle, doch genauso wie ein Kelpie auf die meisten Menschen verführerisch und anziehend wirkt und manchmal Leute ertränkt, kann ein Nuckelavee es nicht vermeiden, hin und wieder die Ernte verrotten, Pflanzen welken oder Dürre entstehen zu lassen. Keine keltische Sagengestalt wird mehr gefürchtet, doch für mich ist es nur lästig, wieder so viele Lebensmittel wegschmeißen zu müssen. Während ich einen neuen Einkaufszettel beginne, murmelt Nickel eine leise Entschuldigung.
Als wir noch klein waren und noch nicht wussten, dass unsere Menschengestalt nur Fassade ist, besuchten wir von benachbarten Dörfern aus dieselbe Grundschule. Wir machten uns von der letzten Reihe aus über Father Collinsʼ Akzent lustig, flochten einander die Haare und rupften uns mit großem Gelächter die Pflaster von den Knien, und auch wenn ich Nickel nie dazu überreden konnte, mit mir schwimmen zu gehen, wurden wir doch unzertrennlich – seit dem Tag, an dem wir gemeinsam an einer roten Ampel standen, neben uns ein Auto mit laut aufgedrehtem Radio hielt und wir beide ohne Absprache anfingen, wild zu tanzen. Wir taten das jahrelang bei jedem Auto, wir tanzten zu jedem Lied, das bis raus auf die Straße dröhnte, doch schließlich musste meine Familie Schottland verlassen. Bevor die Pubertät die dämonische Seite in uns erwachen ließ und unsere Eltern uns erklärten, was wir eigentlich sind.
Als wir uns wiedertrafen, an einer Universität, an der ich Meeresbiologie studieren wollte und sie Geschichte, stand für keinen von uns infrage, dass wir zusammenziehen mussten. So verschieden unsere Wege auch waren, es fühlte sich einfach richtig an.
Und jetzt müssen wir zum dritten Mal dieses Semester die kompletten Vorräte an Brot, Reis und Nudeln neu kaufen.
„Das ist doch früher nicht so oft passiert“, sage ich, während ich den randvollen Müllsack vor die Wohnungstür trage. „Ist alles in Ordnung bei dir?“
„Wahrscheinlich hab ich nur schlecht geschlafen“, antwortet Nickel leise. „Ich sag ja, es tut mir leid.“
„Geschlafen, ja, klar“, schnaube ich. „Ich hab die ganze Nacht deine Musik gehört!“
„Und ich hab gehört, wie du dein Tinder-Date zu Brei getreten hast! Und jedes Mal sitzt du am nächsten Morgen hier und mixt dir Avocado-Smoothies und pfeifst, als wäre überhaupt nichts passiert. Dabei hast du deine Kräfte genauso wenig unter Kontrolle! Du brauchst gar nicht so tun, als würde bei dir immer alles so perfekt laufen!“
Ich will etwas erwidern, da ist sie schon an mir vorbeigerauscht. Mit dem Knallen ihrer Zimmertür endet das Gespräch. Und sofort wird wieder laute Musik aufgedreht.
Wie sich herausstellen sollte, fühlte sich das Zusammenwohnen vor allem richtig an, weil wir beide ähnliche Wurzeln hatten. Natürlich wussten wir das nicht voneinander. Wir erkannten unsere wahren Naturen erst, als wir uns irgendwann zufällig nachts im Flur trafen, gedankenverloren wie Leute, die im Halbschlaf einfach nackt ins Bad gehen, weil sie nicht damit rechnen, dass gerade andere Menschen aus der WG anwesend sind. Nur dass wir zusätzlich in Pferdegestalt waren. Ich als Kelpie mit Algen in der Mähne, nassem Fell und einer Flosse statt eines Schweifs. Sie als gehäutetes Pferd mit einem einzelnen roten Auge auf der Stirn und schwarzem Blut in freiliegenden Adern, auf dem Rücken ein genauso hautloser Menschentorso mit Armen bis zum Boden und einem Kopf, der pausenlos hin- und herzuckt.
Wenn du nachts im Flur unerwartet einem Nuckelavee gegenüberstehst, musst du danach auch nicht mehr ins Badezimmer.
Einen Grund, Nickel zu fürchten, hatte ich trotzdem nie, im Gegenteil. Sie hat nie ein böses Wort gegen mich in den Mund genommen. Nach unserem Wiedersehen war es, als hätten sich unsere Wege nie getrennt. Wir teilten jede gute und schlechte Neuigkeit. Wir hatten immer offene Ohren und Türen füreinander und immer Platz im Bett, wenn das eigene Zimmer mal zu einsam schien. Umso verwirrender also, dass sie sich seit Semesterbeginn laufend einschließt, mich anblafft und unsere Vorräte eingehen lässt. Irgendwas ist passiert in der vorlesungsfreien Zeit.
Ein kurzer Blick in ihr Zimmer könnte genügen, um zu erfahren, was sie dort die ganze Zeit treibt, doch keine Chance: Als Nuckelavee entstammt Nickel zwar dem Meer, meidet aber jedes andere Wasser. Sie muss nie nachts raus, um etwas zu trinken, und die Dämonin in ihr sorgt dafür, dass sie unser Bad höchstens einmal im Monat aufsuchen muss. Ansonsten verlässt sie die Wohnung nur zu Univeranstaltungen mit Anwesenheitspflicht – und von denen findet keine statt, während ich allein zu Hause bin.
Also werde ich besonders leise und aufmerksam. Ich bewege mich lautlos über mein Parkett, um jedes Detail mitzukriegen, das von nebenan durch die Wand dringt. Oder ich presse einfach mein Ohr gegen die Tapete und hoffe, dass zwischen Funeral Doom und Industrial Death Metal ein Hinweis auf das zu hören ist, was Nickel vor mir verheimlicht.
Währenddessen swipe ich am Handy durch Typen, die mich gern kennenlernen wollen, und hoffe weiter, mal jemanden zu finden, der unser erstes Date nicht als unförmige Wasserleiche beendet. Allein schon, weil meine Mutter dann nicht ständig fragen muss, wann sie denn mit Enkelkindern rechnen kann.
Nachdem ich widerwillig ein paar Dutzend potenzielle Traumprinzen geliked hab, verstummt das Grölen und Gitarrengeschrammel aus Nickels Zimmer. Stattdessen höre ich ihr Handy brummen. Niemand in unserem Alter benutzt sein Telefon als Telefon – es können nur ihre Eltern sein. Ich drücke mein Ohr noch fester gegen die Wand.
Und natürlich klingelt es genau in diesem Moment an der Wohnungstür.
Ich stöhne auf und schlurfe durch den Flur, vorbei an Nickels Zimmer, und öffne einer fremden Frau, ich in Jogginghose und Twilight-Sparkle-Shirt, sie in Polizeiuniform. Sie stellt sich vor und erkundigt sich nach meinem Namen, doch meine Aufmerksamkeit gilt vor allem der Tür ein paar Schritte weiter, hinter der Nickel telefoniert. Die Polizistin hält mir ein Foto vor die Nase. Ihr Namensschild sagt: Harper. Ihr Mund sagt:
„Hatten Sie in den letzten 24 Stunden Kontakt zu diesem Mann?“
Ich tue besorgt und bestätige, dass er und ich ausgegangen sind. Wir waren in einer Bar und am Fluss, und dann hat er mich noch nach Hause begleitet. Er ist nicht mit in die Wohnung gekommen.
Aus Nickels Zimmer höre ich: „Aber ich lebe gerne hier!“
„Während des Dates“, sagt Officer Harper, „hat er sich da irgendwie verdächtig verhalten?“
Ich sage, dass ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, natürlich sind wir beide etwas angespannt gewesen. Ich will aber nicht ausschließen, dass er auch aus anderen Gründen nervös war.
Nickel ruft: „Und was ist mit dem, was ich will?“
Die Polizistin fragt: „Hat er irgendwelche privaten Probleme erwähnt? Irgendjemanden, der ihm eventuell schaden wollte? Streitereien in der Familie? Falls Ihnen noch etwas einfällt, geben Sie uns bitte Bescheid.“
„Ihr könnt mich nicht zwingen“, brüllt Nickel in ihrem Zimmer.
Ich lasse mir Officer Harpers Karte geben und versichere ihr, dass ich in Kontakt bleibe. Bevor sie geht, bemerke ich noch den Efeu auf dem Fensterbrett im Treppenhaus – ein braunes Gewirr kraftloser Ranken, von dem tote Blätter rieseln. Und ich könnte schwören, dass er noch strahlend grün war, als ich die Tür geöffnet habe. Auch die Tomatenpflanze und der Basilikum am Küchenfenster sind dahin, die Spathiphyllum beim Sofa, der Kaktus auf meinem Schreibtisch. Ich stürme zu Nickels Tür und hämmere auf das Holz ein.
„Hier sind alle Pflanzen gestorben!“, rufe ich. „Was ist denn los mit dir?“
„Hau ab!“ ruft sie nur, und sofort füllt wieder lautes Metal die WG.
Tagelang geht das so weiter. Die nächste Packung Toastbrot wird keine Stunde alt, bevor sie zu Asche zerfällt. Langsam verdorren auch die Bäume und Büsche vor dem Haus. Und Nickel lässt sich gar nicht mehr blicken, bleibt in ihrem Zimmer eingeschlossen und verlässt die Wohnung nur, wenn ich bereits unterwegs bin.
Es ist reiner Zufall, dass ich sie schließlich an der Uni sehe. Während sie noch ahnungslos in der Schlange vor der Mensa steht, verabschiede ich mich hastig von der Kommilitonin, mit der ich auf dem Weg zu einem Seminar war. Aus der Ferne sehe ich, dass Nickel ihr Skateboard unter dem Arm hat, doch ich bin vorbereitet. Schnell krame ich die Inlineskates aus meinem Rucksack, schnalle sie mir um und rausche in Richtung unserer Wohnung. In Pferdeform wäre ich um einiges schneller, doch wenn ich mich am helllichten Tag verwandle, errege ich viel zu viel Aufsehen. Also rolle ich durch die Straßen der Stadt, mit flatterndem Sommerkleid vorbei am Freibad und den Cafés und Geschäften, umkurve schreiende Passanten und Laternen und Hunde, springe Bordsteinkanten hinauf und Treppen hinab und erreiche hochrot und schweißgebadet die Wohnung. Keuchend hetze ich die Stufen hoch, schließe auf und stürme in den Flur – nur um über Nickels Skateboard zu fallen. Ihre Tür ist verschlossen.
„Oh, jobbie!“, übertöne ich kurz die Musik aus ihrem Zimmer, rapple mich leiser fluchend auf und schmeiße die Skates in die Ecke. „Das kann ja wohl nicht wahr sein!“
Schnaubend stampfe ich ins Bad und drehe den Hahn an der Wanne auf. Wenn mir eines hilft, wieder runterzukommen und mich zu sammeln, wenn ich gestresst oder wütend bin, dann ein ausgiebiges Bad, ganz abgesehen davon, dass meine Haare und das Kleid an mir kleben. Ich gieße die halbe Flasche Vanille-Lavendel-Pflegeschaumbad Soft Delight 2.0 ins Wasser, entzünde ein paar Teelichter auf dem Wannenrand und mache es mir bequem. Während um mich herum die Schaumberge wachsen, denke ich an Nickel, an wen sonst, und je mehr mir das Aroma des Badezusatzes in die Nase steigt, desto ruhiger wird mein Puls. Es ist ja nicht nur so, dass meine beste Freundin mir irgendwas verheimlicht. Ich vermisse es auch einfach, Zeit mit ihr zu verbringen. Ihre Stimme zu hören. Ihr Gesicht zu sehen. Mit ihr nachts nach Hause zu spazieren, nachdem wir tanzen waren, in Clubs statt nur an roten Ampeln, lachend, Arm in Arm, leicht angetrunken und ganz, ganz nah beieinander.
Ich merke erst, wo ich mich bei diesen Gedanken berühre, als das Plätschern des Wassers mich aus den Gedanken reißt. Dann hallt auch schon Nickels Geschrei durch die Wohnung.
„Kelly, du Nugget!“, ruft sie aus dem Flur. „Jetzt übertreibst du es aber!“
Ich setze mich auf und merke erst jetzt, dass die Wanne überläuft, wer weiß, wie lange schon. Die Wasserschicht auf dem Boden erstreckt sich bis zum Spalt unter der Badezimmertür, überall schwimmen kleine Kerzen – und wenn Nickel sich beschwert, heißt das, die unabsichtliche Flut hat sogar schon ihr Zimmer erreicht. Ich drehe den Hahn zu, wickle mir ein großes Handtuch um und wate ihr entgegen.
„Du weißt, wie sehr ich das hasse!“, schreit sie mich an, wie immer ganz in Schwarz, doch noch blasser als das letzte Mal, dass ich sie aus der Nähe gesehen hab. „So ein billiger Trick! Kannst du mich nicht einfach eine Weile in Ruhe lassen? Ich hätte dir schon noch gesagt, was los ist!“
„Es tut mir leid!“, sage ich ihr. „Es war gar keine Absicht!“
„Ja, von wegen! Du schleichst doch seit Wochen um mein Zimmer rum! Komm rein, wenn du es einfach nicht aushältst! Na los, die Tür steht weit offen! Hereinspaziert!“
Sie packt den Saum meines Handtuchs, und ich lasse mich mitreißen. Durch das stehende Wasser zieht Nickel mich in ihr Zimmer. Vom nassen Parkett abgesehen, sieht es aus wie sonst auch. An den Wänden hängen Poster der Bands, die sie ständig hört. Auf ihrem Nachttisch steht ein gerahmtes Bild von mir, daneben eines ihrer Eltern – ihre Mutter warm lächelnd, ihr Vater mit streng zusammengekniffenen Lippen und den stechend grauen Augen, die mir schon als Kind Angst gemacht haben. Dann fällt mein Blick auf den Schreibtisch.
„Na, zufrieden?“, seufzt Nickel und lässt sich auf ihr Bett sinken.
Anstelle von Büchern, Stiften und Papieren liegt dort ein Dutzend Brotlaibe aufgereiht, perfekt drapiert wie für eine Bäckerei-Broschüre, doch alles andere als appetitanregend. Ein paar der Brote sehen einwandfrei aus, doch eines ähnelt mehr einem dicken Kohlebrocken, eines ist komplett mit grauem Pelz überzogen, und die meisten befinden sich in skurrilen Zwischenstadien, mit Schimmel, der exakt bis zur Hälfte verläuft, oder Mustern aus Asche, die sich kunstvoll über die Kruste ziehen. Hier ist nichts rein zufällig verdorben.
„Trainierst du deine Kräfte?“, höre ich mich leise sagen. „Aber … wieso?“
Nickel hat das Gesicht in den Händen vergraben, durch ihre Finger höre ich gedämpftes Schluchzen. Ich setze mich zu ihr und lege einen Arm um sie, sie lehnt den Kopf an meine Schulter. Es dauert eine Weile, bis ich aus ihrem Schluchzen wieder Worte heraushören kann.
Sie sagt, ihre Eltern wollen, dass sie nach Schottland zurückkehrt. Sie sagt, sie soll ihr Studium abbrechen und endlich anerkennen, was sie wirklich ist. Der Menschenwelt den Rücken kehren und ihre dämonische Seite ausleben, wie all die Generationen vor ihr es getan haben, sobald sie alt genug waren. Offiziell soll sie die Geschäftsleitung im Familienunternehmen übernehmen, doch eigentlich ist das nur ein Vorwand.
Ich starre sie mit großen Augen an. Nickel redet schniefend weiter.
„Ich habe geübt, damit sie später nicht enttäuscht sind von mir“, sagt sie. „Es tut mir leid, dass so viel Essen vergammelt ist.“
„Vergiss das Essen!“, sage ich. „Hast du wirklich vor, wieder zurückzuziehen? Ich hab dich doch am Telefon streiten hören! Das klang nicht, als wärst du so begeistert von der Idee.“
Noch während ich spreche, bricht sie wieder in lautes Schluchzen aus. Sie drückt sich an mich, ihr Kopf an meinem nassen Hals, ihre Arme um mich geschlungen. Ich halte sie, bis sie sich beruhigt hat.
„Ich weiß“, sage ich, „dass ich als Kelpie Männer verführen sollte und sie irgendwo ins Wasser locken und da ertränken. Manchmal überkommt es mich ja, aber eigentlich will ich das auch nicht. Ich will überhaupt keinen Mann. Keine Dates und keinen Traumprinzen auf einem Pferd, der meiner Mutter Enkelkinder schenkt. Was kümmert es uns, was andere von uns erwarten?“
Nickel entlässt mich aus ihrer Umarmung. Sie wischt sich über Augen und Nase.
„Wahrscheinlich hast du recht“, sagt sie. „Tradition ist Gruppenzwang durch Tote. Dass ich Schwarz trage, heißt nicht, dass ich will, dass alle sterben. Dass ich Death Metal höre, heißt nicht, dass ich Spaß daran habe, Epidemien zu verbreiten. Ich hab nur die ganze Zeit meine Familie im Kopf. Es fühlt sich an, als hätte ich ununterbrochen meinen Vater im Nacken.“
Ich klappe den Bilderrahmen auf dem Nachttisch um.
„Scheiß auf unsere Eltern“, sage ich. „Du kannst nicht die ganze Zeit in deinem Zimmer sitzen und Brot schimmeln lassen. Wir waren schon ewig nicht mehr zusammen unterwegs! Lass uns ausgehen! Lass uns einfach machen, was wir wollen, das wird dir bestimmt guttun.“
Ich weiß, dass ein lustiger Abend keines ihrer Probleme löst, doch im Moment würde ich alles dafür tun, Nickel wenigstens kurz wieder glücklich zu sehen. Ich schaue sie an, lächelnd, und hoffe, es färbt ab.
„Wenn du meinst“, sagt sie schließlich. „Es gibt da was, was ich schon lange mal machen wollte.“
Ich sehe sie fragend an.
„Lass uns um die Häuser ziehen“, sagt sie. „In Pferdeform!“
Kurz steht mir der Mund offen, dann fange ich an, den Gedanken zu verstehen. Wir sind Dämonen, die Tod und Zerstörung bringen. Niemand rechnet damit, dass wir durch die Nacht laufen und einfach nur Spaß haben. Also tun wir genau das.
Während die Sommersonne hinter der Skyline verschwindet, treten zwei keltische Sagengestalten auf die Straße und beginnen, durch die Stadt zu galoppieren. Wir kümmern uns nicht darum, wer uns sieht und wie die Menschen reagieren, wir bleiben ihnen ja sowieso nicht in Erinnerung. Ich freue mich über die Sonne auf dem Fell und den Wind in der Mähne, und die Dämonin an meiner Seite genießt beides auch ohne Haut und Haar. Wir erschrecken einen Eisverkäufer und futtern die Vorräte aus seinem Wagen. Statt Männer anzulocken und zu verführen, rasen wir auf sie zu und amüsieren uns wiehernd, wenn sie schreiend fliehen. Als wir an einer viel befahrenen Straße im Stadtkern anhalten, kommt neben uns eine Autofahrerin zum Stehen und glotzt uns an. Aus ihrem Wagen dröhnt laute Musik, irgendein Ohrwurm-Hit eines Popsternchens aus den Charts, und ich muss Nickel nicht mal ein Zeichen geben – als hätten wir uns abgesprochen, fangen wir beide zu tanzen an, die ewig nasse Stute mit der Flosse und das gehäutete Ross mit dem Menschentorso auf dem Rücken. Wir springen wild hin und her, lachen in einer Sprache, die nur wir verstehen, und bewegen uns im Rhythmus, bis die gaffende Fahrerin kreischend Reißaus nimmt und das Lied in der Ferne verstummt. Was sie in Panik versetzt und zur Flucht getrieben hat – ich könnte es mir stundenlang ansehen. Und langsam wird mir klar: Ich kann Nickel nicht gehen lassen. Wer soll denn sonst mit ihr tanzen?
Unser Ausritt führt uns weiter zur Universität, wo wir die Bronzestatue des Dekans umschubsen, die keiner der Studierenden dort haben will, und als es bereits völlig dunkel geworden ist, finden wir uns vor dem Freibad wieder. Auf der Wand neben dem Eingang prangt ein stilisiertes Seepferdchen. Mit einem Satz habe ich die Mauer um das Gelände überwunden. Nickel folgt mir ohne nachzudenken.
Zu unserer Rechten geht es zu den Wasserrutschen, links liegt das flache Becken für die Nichtschwimmer. Vor uns erstrecken sich die langen Bahnen mit den Sprungtürmen am Ende, still und weit wie ein See in den Highlands. Nur das Sternenlicht spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Aber natürlich ist Nickel nicht begeistert.
„Da kriegen mich keine zehn –“
„Was ich schon immer mal machen wollte“, unterbreche ich sie, „ist, nachts schwimmen zu gehen, wenn niemand anderes hier ist!“
„Nuckelavees gehen nicht ins Wasser“, sagt sie. Der sehnige, langarmige Torso auf ihrem Rücken zuckt mit dem Kopf und neigt sich in meine Richtung. „Was, wenn meine Eltern davon erfahren würden?“
„Deine Eltern sind nicht hier, und du kannst tun und lassen, was du willst! Magst du wirklich kein Wasser oder hältst du dich nur fern, weil es dir so beigebracht wurde?“
„Ich …“ Sie zögert. „Ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie schwimmen!“
Der Menschenkopf scheint zu nicken. Seine hautlosen Lippen sind streng zusammengekniffen, seine Augen stechend grau. Mir läuft ein Schauer über den Rücken und Nickels Satz durch den Kopf. Als hätte ich ununterbrochen meinen Vater im Nacken.
Sie zittert. Doch der Torso, der zittert nicht. Er starrt mich einfach nur an. Und ich fasse einen Entschluss, bevor ich zu lange darüber nachdenken kann.
„Weißt du noch“, frage ich, „wie wir uns früher immer gegenseitig die Pflaster von den Knien gerupft haben?“
„Ja?“
„Das wird jetzt exakt genauso.“
Nickel will fragen, was ich meine, da schnappe ich schon nach einem der Arme, die von dem Auswuchs auf ihrem Rücken zu Boden hängen, und renne nach links. Völlig überrascht lässt sie sich mitschleifen, stolpert mir seitlich gehend nach, durch das dunkle Freibad, bis an den Rand des flachen Nichtschwimmerbeckens. Ich zerre ruckartig an dem Arm, und Nickel landet ächzend auf der Seite.
„Was machst du denn da?“, schreit sie und windet sich, um zu sehen, was ich hinter ihrem Kopf treibe, und allein, dass sie es nicht merkt, bestätigt, was ich gehofft hatte. Der Torso ist kein Teil von ihr. Sie spürt nicht, wie ich seinen Kopf unter Wasser drücke. Wie ich mein Gewicht auf seinen Schulterblättern verstärke. Wie ich zustampfe, wenn er zappelt, wieder und wieder und wieder, während Nickel nur fragt, was eigentlich vor sich geht. Es ist zu dunkel, um zu sehen, wie das Wasser sich verfärbt. Wer in der Nähe wohnt, hört nur schwaches Wiehern und kraftloses Platschen. Schließlich hört der Torso auf zu zucken.
Nickel versucht, sich aufzurappeln. Mit einem Ruck schafft sie es wieder auf alle Viere, der menschliche Auswuchs bleibt im Wasser unter meinen Hufen. Für einen Moment friert sie ein, starrt den entfernten Reiter einfach nur an, der sonst immer außerhalb ihrer Sichtweite gewesen ist. Sie nimmt wieder ihre Menschengestalt an, klein und blass und nackt, und tastet auf ihrem Rücken herum. Sie dreht sich, und auch ich sehe, dass sie keine Wunde behält, keine Narbe, keinen blauen Fleck. Auf ihrem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus.
„Oh mein Gott!“, sagt sie und läuft auf mich zu. Bevor sie mich erreicht, bin auch ich wieder menschlich. Ungebremst stürmt Nickel mir entgegen und schließt mich in die Arme.
„Danke“, murmelt sie in mein Haar. „Danke, danke, danke!“
Der Torso im flachen Wasser löst sich langsam zu Asche auf. Wir stehen eng umschlungen am Beckenrand. Ich spüre Tränen in meinen Augen, Nickels Herzschlag an der Brust und plötzlich ihre Lippen auf meinen. Ich weiche keinen Millimeter.
Als unsere Gesichter sich wieder voneinander lösen, sehe ich, dass auch Nickel feuchte Augen hat. Sie lächelt, so breit wie vielleicht noch nie.
„Das“, sage ich, „wollte ich auch schon lange mal machen.“
Für eine Weile stehen wir einfach nur da, nackt und grinsend, unter den Sternen, am Wasser. Es fühlt sich einfach richtig an. Nickel muss nicht sagen, dass sie bleibt. Dass wir es gemeinsam schaffen, uns nicht von den Erwartungen unserer Familien einsperren zu lassen. Ihre Augen sagen all das ohne Worte. Ihr Mund hingegen sagt etwas, womit ich nicht gerechnet hätte:
„Zeigst du mir, wie man schwimmt?“
Also nehme ich ihre Hand und gehe mit ihr zum großen Becken. Zum ersten Mal führe ich eine Person ins Wasser, ohne ihr schaden zu wollen. Ganz im Gegenteil. Und offenbar war nie ein Traumprinz nötig gewesen, um mich glücklich zu machen. Mir genügt das Pferd.